Eine Spurensuche
Hannah Arendt saß 1961 im Gerichtssaal in Jerusalem und schaute sich Adolf Eichmann an – und sah keinen Teufel, sondern einen Langweiler!
Kann das sein? Kann jemand, der Hunderttausende in den Tod schickte, einfach nur öde sein?
Aus dieser Begegnung entstand eine der verstörendsten Thesen des 20. Jahrhunderts:
Das Böse ist banal. Eichmann hatte nicht aus Hass gehandelt, nicht aus Sadismus. Er hatte Befehle ausgeführt, Karriere machen wollen, seine Arbeit ordentlich erledigen wollen. Er hatte – und das war für Arendt das Entscheidende – nie wirklich nachgedacht.
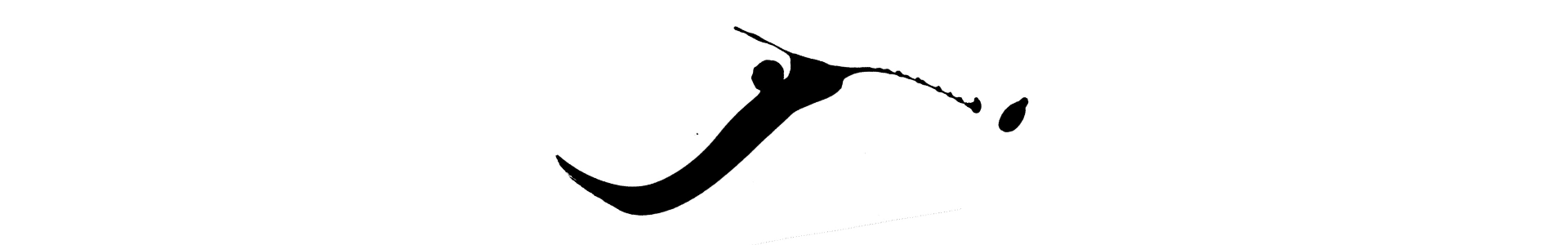
Wer aufhört zu denken, kann zu allem werden
Denken ist für Arendt keine Kopfsache, sondern Herzensangelegenheit. Wer nicht innehält, wer nicht mit sich selbst spricht, wer einfach nur funktioniert – der verliert etwas Entscheidendes.
Aber reicht das als Erklärung?
Arendt selbst rang mit dieser Frage. In ihrem 1951 erschienenen Werk “Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft” hatte sie noch einen anderen Begriff verwendet: das “radikal Böse”. Die Konzentrationslager, die industrielle Vernichtungsmaschinerie – etwas so Ungeheuerliches, dass es alle moralischen Kategorien sprengt. Später schrieb sie an Gershom Scholem: “Ich bin in der Tat heute der Meinung, dass das Böse immer nur extrem ist, aber niemals radikal, es hat keine Tiefe, auch keine Dämonie.”
Vielleicht ist es so: Die Systeme sind radikal. Die Menschen darin banal. Möglicherweise braucht es gerade die Gedankenlosen, damit das Radikal-Böse funktioniert.
Arendt beschrieb das Böse als Pilz, der über die Erde wuchert, ohne je Wurzeln zu schlagen. Keine Tiefe, keine Substanz. Nur Oberfläche.
Und das bedeutet: Jeder kann zum Täter werden, wenn er aufhört zu denken.
Viel unbequemer als die Vorstellung von Monstern, die grundsätzlich anders sind als wir.
