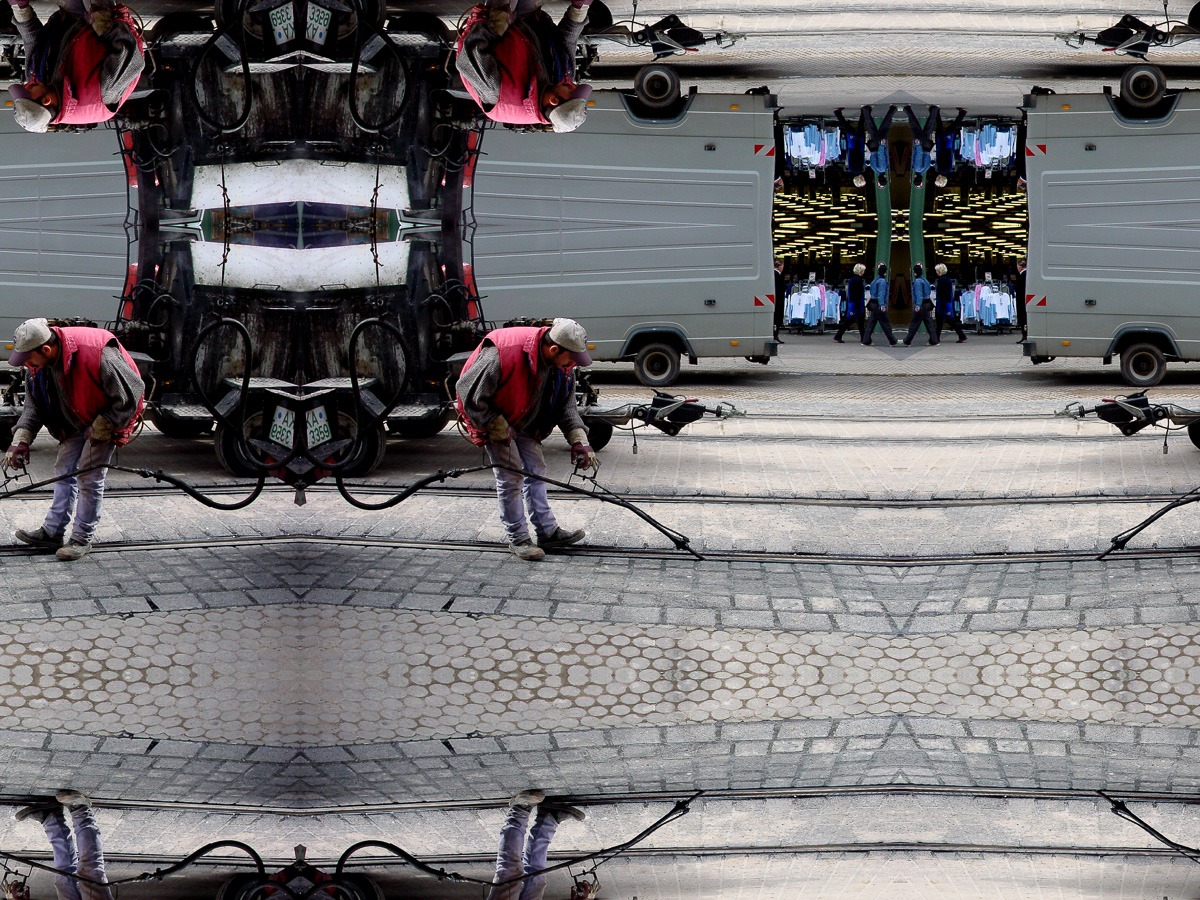Manchmal beginnen große Ideen mit einem kleinen Nein. Udo Herrmannstorfer sagte dieses Nein in den frühen Neunzigerjahren, als die Euphorie des freien Marktes alle Widerstände übertönte. Er nannte sein Buch „Schein-Marktwirtschaft – Die Unverkäuflichkeit von Arbeit, Boden und Kapital“. Ein Titel, der so sperrig klang, dass man ihn kaum auf einen Werbebanner drucken konnte – und gerade deshalb seiner Zeit voraus war. Denn Herrmannstorfer fragte etwas Unbequemes:
Was, wenn das, was wir verkaufen, gar nicht uns gehört?

Die westliche Wirtschaft lebt von der stillen Übereinkunft, dass alles einen Preis hat. Arbeit wird nach Stunden bezahlt, Boden nach Quadratmetern, Kapital nach Rendite bewertet. Das klingt vernünftig, fast naturgegeben. Doch Herrmannstorfer drehte die Perspektive um. Er sagte: Diese Dinge sind nicht Waren, sondern Grundlagen des Lebens – und wer sie wie Produkte behandelt, zerstört genau das, wovon er lebt.
In einer Zeit, in der Wirtschaft noch als Naturgesetz galt, war das fast Sakrileg. Und doch traf sein Gedanke einen Nerv. Denn die Logik des Kaufens und Verkaufens hat längst auch jene Bereiche besetzt, die eigentlich jenseits des Preises liegen sollten: Erziehung, Pflege, Boden, Wissen. Wir kaufen Lebenszeit, mieten Atmosphäre, handeln mit Emissionen. Die Welt als Börsenparkett.
Herrmannstorfer formulierte, was viele ahnten, aber kaum aussprachen: Dass das ökonomische Prinzip des Tauschwerts an seine Grenze stößt, wenn es das Leben selbst betrifft. Arbeit ist keine Schraube, die man eindreht. Boden ist kein Rohstoff, der sich vermehren lässt. Kapital ist kein Naturgesetz.
Die unsichtbare Grenze des Marktes
Das war sein Kern: Wenn die Grundlagen des Lebens – Arbeit, Boden, Kapital – zur Ware werden, verliert die Gesellschaft ihr Gleichgewicht. Denn der Markt ist ein geniales, aber blindes System: Er weiß, wie man Knappheit verteilt, aber nicht, wie man Sinn erzeugt. Herrmannstorfer schrieb gegen diese Blindheit an. Nicht als Moralist, sondern als Praktiker des Sozialen.
Herrmannstorfer forderte eine Wirtschaft, die den Menschen nicht als Mittel zum Zweck behandelt, sondern ihn selbst zum Zweck erhebt – eine „assoziative Wirtschaft“, wie er sie nannte: ein System, das sich seiner selbst bewusst ist, statt bloß zu funktionieren.
Der Begriff klingt altmodisch, doch im Kern beschreibt er das, was heute als „Purpose Economy“ durch Vorstände geistert: Unternehmen, die nicht nur Produkte, sondern Bedeutung erzeugen. Nur dass Herrmannstorfer diesen Gedanken 30 Jahre früher hatte – in einer Zeit, als Aktien noch per Faxkurs zirkulierten.
Arbeit – der verkaufte Atem
Beginnen wir mit der Arbeit. Herrmannstorfer nennt sie das „lebendige Tun eines Menschen“. Das klingt poetisch, ist aber ökonomisch brisant. Denn wenn Arbeit nicht Ware ist, dann ist der Arbeitsmarkt, wie wir ihn kennen, eine Illusion. Er bewertet Menschen nach Zeit und Funktion, nicht nach Wirkung oder Tiefe.
Das Ergebnis ist bekannt: Burnout, Entfremdung, Sinnsuche in Nebenprojekten. Der Mensch verkauft Stunden, in denen er nicht lebt, um sich danach Zeit zu kaufen, in der er leben darf. Ein Paradox, das ganze Branchen beschäftigt.
Herrmannstorfer schlägt keinen Aufstand vor, sondern eine Neuorientierung: Arbeit sollte Ausdruck dessen sein, was man beitragen will, nicht das, was man ertragen muss. Sie ist Beziehung, nicht Transaktion. Diese Idee klingt romantisch, bis man bemerkt, dass sie der modernen Ökonomie schleichend Recht gibt: In einer Wissensgesellschaft ist Wert längst nicht mehr das Produkt der Zeit, sondern der Kreativität. Der nächste Schritt wäre, das auch in den Systemen anzuerkennen – von Lohn über Bildung bis Steuerrecht.

Boden – das Gedächtnis der Gesellschaft
Der zweite Pfeiler seiner Kritik ist der Boden. Kaum etwas wirkt so unscheinbar und ist zugleich so umkämpft. Boden ist endlich. Er lässt sich nicht herstellen, nur verteilen. Trotzdem behandeln wir ihn, als ließe sich Wachstum in Quadratmetern messen.
Herrmannstorfer nannte das „eine Verwechslung von Besitz und Beziehung“. Wer Boden besitzt, hat Verantwortung – nicht Freiheit. In der Praxis aber kehrt sich das Verhältnis um: Je mehr Fläche, desto mehr Macht, desto mehr Rendite. Und desto weniger Zugang für alle anderen.
Die Folgen sind sichtbar: explodierende Immobilienpreise, zersiedelte Landschaften, Städte, die Menschen verdrängen. Boden wird zum Spekulationsobjekt, nicht zum Lebensraum. Das erinnert an die Warnungen von Karl Polanyi, der 1944 in The Great Transformation schrieb, dass Boden keine Ware sei, weil er nicht produziert wurde. Herrmannstorfer nahm diesen Gedanken auf und übersetzte ihn in die Sprache des ausgehenden 20. Jahrhunderts – mit Blick auf die kommende Krise: die ökologische.
Denn wer den Boden verkauft, verkauft seine Zukunft. Eine Gesellschaft, die ihr Land an den Höchstbietenden gibt, handelt, als könne man Luft pachten und Wasser verpfänden.
Kapital – der entlaufene Diener
Bleibt das Kapital, der dritte der heiligen Drei. Herrmannstorfer verstand es als verdichtete Beziehung zwischen Menschen – Vertrauen in die Zukunft, nicht Mittel zur Macht. Kapital war für ihn kein Feindbild, sondern ein Werkzeug, das sich verselbständigt hat.
Heute würde man sagen: Das Kapital hat sich von der Realwirtschaft entkoppelt. Geld verdient Geld, ohne dass Arbeit, Boden oder Idee beteiligt sind. In dieser Welt werden Milliarden in Sekunden verschoben, während soziale Innovationen an Bürokratie scheitern.
Herrmannstorfer forderte deshalb eine Rückführung des Kapitals in seine soziale Funktion. Es soll nicht frei sein im Sinne der Entfesselung, sondern frei im Sinne der Verantwortung. Kapital muss wieder wissen, wozu es dient.